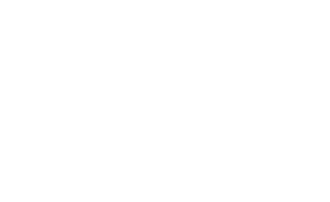barrierefrei.center recherchiert
Die österreichische Bevölkerung erfreut sich eines zunehmend längeren Lebens. Bemerkbar macht sich dieser Wandel speziell in der Gruppe der betagten und hochbetagten Personen, also der Bürgerinnen und Bürger, die 80 Jahre oder älter sind. Bis 2040 wird diese Altersgruppe um 58 Prozent anwachsen, bis 2080 sogar um 144 Prozent, prognostiziert die Statistik Austria.
Diese Veränderungen haben auch Einfluss auf ein System, das bereits heute an der Belastungsgrenze kratzt: die Versorgung pflege- und betreuungsbedürftiger Seniorinnen und Senioren. Prinzipiell stehen hierfür mehrere Optionen zur Wahl: Neben stationären Einrichtungen und Pflegeheimen existieren mobile Pflegedienste und mehr als 900 Vermittlungsagenturen, die zu oft sehr unterschiedlichen Konditionen 24-Stunden-Betreuung anbieten. Wie es aus der Branche heißt, wird in vielen dieser Bereiche jedoch am Limit gearbeitet.
Sparkurs als schweres Erbe
Aufgrund des Personalmangels gebe es bei mobilen Pflegediensten bereits Wartelisten, bemängelt Helmut Lutz, Geschäftsführer von Malteser Care. In stationären Einrichtungen und Pflegeheimen – die meist jedoch deutlich teurer seien als eine 24-Stunden-Betreuung – sehe die Lage nicht besser aus. Doch wie konnte eine der reichsten Nationen der Welt an einen Punkt gelangen, an dem die Versorgung im Alter nicht für alle zu gleichen Konditionen und in gleicher Qualität garantiert werden kann?
An der Universität Linz beschäftigt sich die Soziologin Brigitte Aulenbacher seit Jahren mit dem Thema Pflege. Eine wesentliche Ursache der heutigen Versorgungslücken sieht sie in den politischen Entscheidungen der vergangenen Jahrzehnte. In fast allen europäischen Ländern, aber auch in anderen Industriestaaten rund um den Globus, kam es in den vergangenen 50 Jahren zu einem teils drastischen Abbau des Sozialstaats. Diese Einsparungen äußern sich unter anderem in einem Phänomen, das sich sowohl in Österreich, aber auch in Nachbarländern wie der Schweiz und Deutschland beobachten lässt.
In allen drei Ländern haben traditionelle Altenheime einen relativ schlechten Ruf. „Es ist das Image eines Sektors, der nicht in angemessener Weise finanziert ist“, attestiert Aulenbacher. Daneben sieht die Forscherin ein weiteres Versäumnis: „Österreich und viele weitere europäische Staaten haben nicht ausreichend in die Pflegeinfrastruktur investiert.“ Betrachte man die österreichische Pflegereform, die 2022 beschlossen wurde, werde deutlich, dass in Hinblick auf eine flächendeckende Versorgung nur geringe Investitionen eingeplant seien. Zwar sei darin die Finanzierung von Community-Nurses vorgesehen, die bedarfsorientiert auf Gemeindeebene Beratung und Unterstützung für ältere, zu Hause lebende Menschen und deren Angehörigen anbieten. Dennoch sei viel zu wenig Budget veranschlagt, um die tatsächlich benötigte Infrastruktur auch in ruralen Gebieten garantieren zu können.
Laut OECD-Statistik investiert Österreich 1,7 Prozent des BIP in verschiedene Formen der Langzeitpflege, in Norwegen sind es 3,4 Prozent des BIP. „Wir sind mit einem höchst problematischen Mangel an Sozialinvestitionen konfrontiert“, sagt Aulenbacher. In dieser Situation ist die Versorgung älterer Menschen in Form der 24-Stunden-Betreuung eine gangbare Lösung. Aktuell wird diese von mehr als 30.000 Haushalten in Anspruch genommen. Es wäre schier unmöglich, die betroffenen Menschen in anderer Weise zu versorgen, heißt es aus Forschung und Praxis.
Wie auch die Idee der Community-Nurses zielt das Konzept darauf ab, dass betagte Personen im eigenen Zuhause versorgt werden können. Die Maxime der Betreuung im Privathaushalt ist in Österreich und anderen zentraleuropäischen Staaten tief verwurzelt.
Familien in der Pflicht
Damit unterscheiden sie sich von nordischen Ländern und auch Frankreich, wo bei Sorgeleistungen und der nötigen Infrastruktur deutlich stärker auf die Verantwortung der öffentlichen Hand gesetzt wird. Österreich sei hingegen in der Tradition einer Home-Care-Gesellschaft verhaftet, erklärt Aulenbacher: „Diese Gesellschaften bauen auf die Idee, dass Sorgearbeit innerhalb der Familie erbracht wird und der Staat mit Geldleistungen unterstützt.“ Wie es seitens der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger heißt, stellt die Betreuung und Pflege durch Familienmitglieder den größten Pflegedienst der Nation dar, ohne den die Betreuung der Betroffenen zu Hause nicht möglich wäre. So wurden im Jahr 2019 rund 70 Prozent aller Pflegegeldbezieherinnen und -bezieher von Angehörigen – teils mit Unterstützung mobiler Dienste – zu Hause betreut. Doch diese Art der Versorgung bröckelt.
Viele der (größtenteils weiblichen) pflegenden Angehörigen wollen oder können die unbezahlte Arbeit nicht zusätzlich zur eigenen Erwerbsarbeit erfüllen. Hinzu kommt eine größere räumliche Mobilität, auch die sinkende Kinderzahl hat Einfluss auf die innerfamiliäre Aufteilung von Sorgearbeiten.
Die Nachfrage nach leistbarer Abhilfe rückt wiederum die 24-Stunden-Betreuung in den Fokus.Gestützt wird dieses System überwiegend von Arbeitsmigrantinnen, die zum größten Teil aus Osteuropa stammen und temporär zum Arbeiten nach Österreich reisen. Kamen diese Care-Arbeiterinnen bis vor wenigen Jahren hauptsächlich aus der Slowakei, bildet Rumänien heute das größte Entsendeland für 24-Stunden-Betreuerinnen. Wie sich in der Vergangenheit zeigte, verlassen die Arbeitskräfte das Feld der Altenbetreuung, wenn sich in ihrem Heimatland die wirtschaftliche Situation bessert oder es Jobalternativen zur physisch wie psychisch anstrengenden Betreuungsarbeit gibt.
Das war im Großraum Bratislava der Fall, wo bis vor wenigen Jahren viele Care-Arbeiterinnen für den österreichischen Markt rekrutiert wurden. Spricht man mit rumänischen Betreuerinnen, könnte auch ihre Arbeitskraft bald wegfallen. „Ich verdiene in Österreich noch knapp 200 Euro mehr, als ich in Rumänien verdienen könnte“, sagt eine Care-Arbeiterin, die anonym bleiben will. Allerdings: „Wenn ich auf diese 200 Euro verzichte, kann ich jeden Abend und auch am Wochenende bei meiner Familie sein.“
Verlust von Care-Kräften
Eine Studie der Universität Wien zeigt, dass nur die Minderheit der Care-Kräfte in diesem Sektor bleiben möchte. Laut der Erhebung, für die knapp 2300 Fragebögen und die Ergebnisse aus Fokusgruppen ausgewertet wurden, wollen lediglich 32 Prozent der Befragten in der derzeitigen Form weiter in dem Bereich arbeiten. So gelte es künftig nicht nur, neue Arbeitskräfte für die Personenbetreuung zu gewinnen, sondern auch die bestehenden Kräfte zu halten, sagt Michaela Schaffhauser-Linzatti von der Uni Wien. Das könne gelingen, indem standardisierte Verträge sowie einheitliche Qualitätsstandards etabliert und Plattformen geschaffen werden, die relevante Informationen auch in der Muttersprache der 24-Stunden-Betreuungskräfte anbieten.
Daneben können mehr Wertschätzung durch die Politik und höhere Tagsätze helfen, Care-Arbeitende zu halten. Doch: „Vielen Betroffenen fehlt der Spielraum für die Bezahlung entsprechender Honorare“, sagt Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerk Österreich. Auch aus diesem Grund habe das Land zwischen 2019 und Ende 2022 rund 3000 Betreuungskräfte an andere Staaten verloren. Da der Care-Sektor schon heute nicht mehr ohne Arbeitsmigration auskommt, wird kein Weg an größeren Investitionen durch den Staat in die Betreuung betagter Menschen vorbeiführen.
Quelle „Der Standard Morgenausgabe – 12.04.2023″
Fotos: Pexels.com